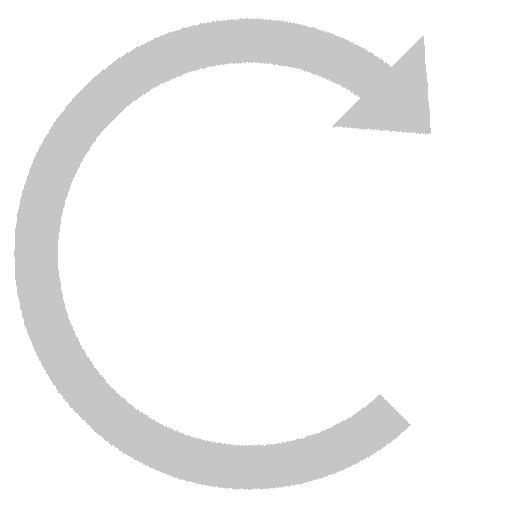Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) plant eine neue Bahnstrategie. Eine schnelle Besserung für die Bahnkunden ist allerdings nicht zu erwarten. Worum es bei dem bundeseigenen Verkehrskonzern nun geht:
Kunde soll in Mittelpunkt rücken
Schnieder will die Strategie zur Reform der Bahn in drei Wochen vorlegen, am 22. September - dann könnte auch klar sein, wer sie als Lutz' Nachfolger umsetzen soll. Den Titel der Strategie immerhin hat das Ministerium schon verraten: "Agenda für zufriedene Kunden auf der Schiene". Das bedeutet: Die Bahn soll den Fahrgast in den Mittelpunkt rücken und viel kundenorientierter arbeiten. Das klingt eigentlich selbstverständlich - aus Sicht des Ministeriums aber scheint das bei der Bahn bisher nicht so zu sein.
In den ARD-"Tagesthemen" sagte Schnieder Mitte August, die Bahn müsse für die Menschen da sein - und nicht umgekehrt. Als Ziel gab der Minister aus: "Die Bahn muss pünktlich, sicher und sauber sein." Die Lage bei der Bahn sei dramatisch, wenn man auf die Unzufriedenheit oder die Pünktlichkeitswerte schaue.
Die Hoffnung auf bessere Pünktlichkeitsquoten
Im Juli war lediglich gut die Hälfte der Fernzüge bei der Bahn pünktlich. Was tun? "Was auf keinen Fall in der Eigentümerstrategie oder gar Bahnstrategie stehen sollte, ist, dass man weniger Züge fahren lässt", sagte Dirk Flege, Geschäftsführer des Interessenverbands Allianz pro Schiene. Eine solche Maßnahme zur Entlastung wichtiger Knotenpunkte werde gerne als kurzfristiger Schritt für mehr Pünktlichkeit genannt. "Das wäre meines Erachtens eine Kapitulation, eine Bankrotterklärung."
Schnieder hat ein solches Vorgehen zuletzt auf Nachfrage im ZDF nicht explizit ausgeschlossen. "Man muss über alle Maßnahmen reden, die dazu führen, dass Netz und Betrieb stabiler werden", sagte der Minister auf die Frage, ob es denkbar sei, mit weniger Zügen schnell zu höheren Pünktlichkeitswerten zu kommen.
Bessere Steuerung durch den Bund - Schlüssel Infrastruktur
Als sicher gilt, dass der Bund die bundeseigene Bahn künftig enger an die Leine nehmen und besser steuern will. Das hat Schnieder vor allem für den Bereich der Infrastruktur immer wieder angedeutet. Das marode Schienennetz gilt als Hauptgrund für unpünktliche Züge. Die am stärksten belasteten Strecken sollen in den kommenden Jahren grundlegend saniert werden.
Zuständig dafür ist die Anfang 2024 gegründete neue Infrastruktursparte InfraGo. Doch ist sie eigenständig genug oder regiert der Konzern zu sehr hinein, aus wirtschaftlichen Interessen? Die Frage ist auch, was genau die "Gemeinwohlorientierung" der Sparte genau bedeutet.
Aus Branchenkreisen heißt es: "Wir brauchen eine eigenständigere Netzgesellschaft, die vom Bund enger gesteuert wird und keine faulen Kompromisse machen muss." Denn das sei ein Problem: "Die überbordende Bürokratie hält das Netz vom Arbeiten ab."
"Kunde der Leidtragende"
Klarere Zuständigkeiten dürften auch in der Branche gut ankommen. "Die Bahn sagt immer: "Die Politik muss." Die Politik sagt immer: "Die Bahn muss." Und der Kunde, der Leidtragende, der kann gar keinen greifen und weiß gar nicht, an wen er sich wenden soll mit seinem Ärger", sagte Flege. Für den Alltagsbetrieb sei natürlich das Bahn-Management verantwortlich. "Die müssen dafür auch geradestehen. Aber sie brauchen dann eben eine klare, verlässliche Grundlage und Richtung von der Politik." Das heiße, das Geld für die Infrastruktur müsse zur Verfügung stehen, die Verantwortlichkeiten müssten glasklar sein.
Flege sagte weiter: "Wir müssen endlich Schluss machen mit dem Gedanken, dass man mit der Schieneninfrastruktur Geld verdienen kann." Es habe zudem keinen Sinn, dass die DB InfraGo bei jeder Baumaßnahme einen Eigenanteil zahlen müsse. Der Bund müsse entscheiden, was er in der Bahn-Politik wolle, und die entsprechenden Vorhaben dann finanzieren. Wenn die Bahn selbst zusätzlich prüfe, ob sie ein Bauvorhaben für finanzierungswürdig halte, würden Projekte verhindert.
Peter Westenberger, Geschäftsführer des Verbands der privaten Güterbahnen, sagte: "Wenn die Strategie die Deutsche Bahn an etwas bindet, hat das zur Folge, dass sie auch den Bund bindet. Nämlich dass er für das, was er da reinschreibt, die Grundlagen gewährleistet."
Vorbild Schweiz?
Mit den Grundlagen ist natürlich Geld gemeint. Und eine langfristige Vorstellung davon, was mit diesem Geld gemacht werden soll. Seit der Bahnreform und der damit verbundenen Gründung der Deutschen Bahn AG 1994 gab es inklusive Schnieder zwölf Bundesverkehrsminister - und ähnlich viele verschiedene Strategien für den Konzern. Lange gab es zu wenig Geld für die Bahn. Kontinuität und ein langfristiger Plan: Fehlanzeige.
Ganz anders lief das in den vergangenen Jahrzehnten in der Schweiz. "Die wissen, wo sie hinwollen, die haben diese klare Aufgabenverteilung. Das Bundesamt für Verkehr steuert in der Schweiz die verkehrspolitischen Linien", sagte Flege. "Da gibt es eine Steuerung, da gibt es eine Strategie, da gibt es Ziele. Und es gibt eine Finanzierungsverlässlichkeit für die Infrastruktur, die weit über die Legislaturperiode hinausgeht."
Das Ergebnis: Die Schweiz ist in den vergangenen Jahrzehnten zum Bahn-Vorzeigeland geworden. Die Pünktlichkeit im Fernverkehr lag 2024 bei 91,2 Prozent. Die DB Fernverkehr schaffte 2024 eine Quote von 62,5 Prozent - bei laxerer Pünktlichkeitsdefinition.
Ist für die Kontrolle der Bahn ein zusätzliches Bundesamt nötig?
Güterbahnen-Geschäftsführer Westenberger wirbt angesichts der Lage für die Gründung eines neuen, kleinen Bundesamtes für Schieneninfrastruktur nach Schweizer Vorbild. "Wir sehen ganz klar das größte Defizit im Moment bei der Steuerung der Infrastruktur. Das Bundesverkehrsministerium hat weder das Personal noch die Instrumente dazu." Das Eisenbahn-Bundesamt und die Bundesnetzagentur hätten an dieser Stelle nur eingeschränkte Kompetenzen. "Keine der drei vorhandenen Stellen ist im Moment oder war in der Lage, die Entwicklung tatsächlich aufzuhalten."
Beklagenswerter Zustand des Schienennetzes
Wie die neue Strategie auch aussehen wird: Bahnreisende werden noch viele Jahre Geduld brauchen, bis sich die Leistung grundsätzlich verbessern wird. Zu kaputt ist die Infrastruktur, die Sanierung kann nicht von jetzt auf gleich gelingen. Im aktuellen Netzzustandsbericht hat die InfraGo dem gesamten Netz die Note 3,0 gegeben. Besonders schlecht sieht es bei den teils uralten Stellwerken aus - Zustandsnote 4,12.
Mit dem Sondervermögen der Bundesregierung für Infrastruktur steht künftig deutlich mehr Geld zur Verfügung. Doch auch strukturell muss sich etwas ändern, da ist sich die Branche einig.
© Fabian Nitschmann und Andreas Hoenig, dpa | Abb.: Deutsche Bahn AG / Volker Emersleben | 31.08.2025 07:34